news
newsletter
archiv
impressum
PawelAlthamer | MichaelAsher | NairyBaghramian | GuyBen-Ner | GuillaumeBijl | MartinBoyce | Jeremy Deller | MichaelElmgreen und IngarDragset | Hans-PeterFeldmann | DoraGarcia |
IsaGenzken | DominiqueGonzalez-Foerster | TueGreenfort | DavidHammons | ValérieJouve | MikeKelley | Suchan Kinoshita | MarkoLehanka | GustavMetzger | EvaMeyer und EranSchaerf | DeimantasNarkevicius | BruceNauman | MariaPask |
ManfredPernice | SusanPhilipsz | MarthaRosler | ThomasSchütte | AndreasSiekmann | RosemarieTrockel | SilkeWagner | MarkWallinger | Clemens von Wedemeyer | AnnetteWehrmann | PaeWhite


Beweglich wie Menschen sind, empfinden sie die Stadt als statisch. Dabei besteht sie aus vielen Rhythmen und stellt sich ihnen, je nachdem aus welcher Himmelsrichtung sie sich ihr nähern und welches Fortbewegungsmittel sie wählen, jeweils anders dar. Valérie Jouve hat einen Film darüber gedreht, wie man sich Münster nähern kann, und zeigt ihn in einer Unterführung, einem Ort, der geradezu sinnbildlich für das Unterwegssein steht. Bei der Projektentwicklung stellte sich heraus, dass der Tunnel einem Obdachlosen als „Wohnzimmer“ dient. Der Obdachlose wurde von der Künstlerin auf seinem Weg durch die Stadt mit der Kamera begleitet. Ihre Darsteller – französische Schauspieler unterschiedlicher Herkunft, die noch nie einen Fuß in die Stadt gesetzt haben – nähern sich Münster von der Peripherie her: Eine Fahrt auf dem Dortmund-Ems-Kanal mit dem Frachtschiff Tahiti von Amelsbüren bis zur Schleuse nördlich von Münster und zurück südlich bis zum Unternehmen Agravis. Umsteigen auf das Fahrrad. Die Kamera folgt den Bewegungen der Akteure durch den Raum, sie wechselt im Laufe des Films die Perspektive, von einem ethnografisch korrekten und unbeteiligten zu einem teilnehmenden Kameraauge aus der Sicht der handelnden Personen. Der Zielpunkt ist der Ort der Projektion, die Fußgängerunterführung am Hindenburgplatz. Der Ton führt ein Eigenleben und folgt nicht den Bildern. Obwohl der Korridor architektonisch auf seine pure Funktion reduziert ist, besitzt er doch (Kunst-)Geschichte. Den Hohlraum zwischen Fußgängerrampe und Fußgängertunnel hat Joseph Beuys 1977 in Talg nachgebaut – so entstand der massige, keilförmige Raum mit dem Titel Unschlitt/Tallow, die heute im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlin ausgestellt ist.
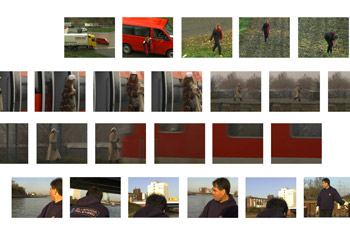
Valérie Jouve umkreist in den Medien Fotografie und Film die Beziehung zwischen Mensch und urbaner Lebenswelt. Die Orte, die Jouve in ihren Arbeiten dokumentiert, stellen weniger identifizierbare Stadtansichten dar als vielmehr Metaphern moderner Urbanität. In nüchterner Klarheit, gezielter Unschärfe oder an der Grenze zur Auflösung in abstrakte Muster bilden sie die Folie, von der sich die Protagonisten im Vordergrund abheben. Die Personen, die vor diese Stadtlandschaften gesetzt sind, formulieren durch ihre ausdrucksstarke Gestik und Mimik, durch die Heftigkeit ihrer Bewegungen ihren eigenen Raum. Die Intensität ihrer Körpersprache und die Inszeniertheit der Szene kontrastieren mit dem dokumentarischen Charakter der planen städtischen Kulissen. Die Gesten und Handlungen der Figuren sind ungerichtet und vieldeutig. Sie transportieren keine Botschaft, zeichnen kein Portrait. Sie sind Ausdruck der Komplexität menschlicher Wirklichkeit und trennen die Figuren dadurch von der Architektur, die Jouve selbst als ‚ordonnance de la société humaine’ bezeichnet. Wenn die Wahl trister, unwirtlicher Vorstadtgebiete in Paris und Marseille, Zeugen einer fehlgeleiteten Stadtplanung, auch den Eindruck von Isolation, Leere und Vereinsamung hervorrufen, so formulieren die Figuren im Vordergrund doch ein positives Gegenbild. Das Spannungsverhältnis von Figur und urbanem Kontext entsteht nicht zuletzt durch das Prinzip der Montage, das für Jouves Arbeitsweise charakteristisch ist. Das Arbeiten mit Versatzstücken ermöglicht ein besonderes Maß der Verdichtung und ein flexibles Raumgefüge, das abseits aller perspektivischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Die kritische Auseinandersetzung mit der modernen urbanen Lebenswelt vermittelt sich folglich über die strategischen Brüche im Bild, die unter anderem durch die Montagetechnik entstehen. Damit wird die Qualität der Fotografie, zugleich Abbildung und Darstellung zu sein, zur Voraussetzung der Bildaussage. Nachdem Valérie Jouve zunächst ausschließlich im Medium der Fotografie gearbeitet hatte, entstand 2000/2002 ihr erster Film, Le Grand Littoral. Ebenso wie ihr zweiter Film Time is working around Rotterdam überträgt er die Thematik der Beziehung von Mensch und urbanem Umfeld auf das Medium des Films.